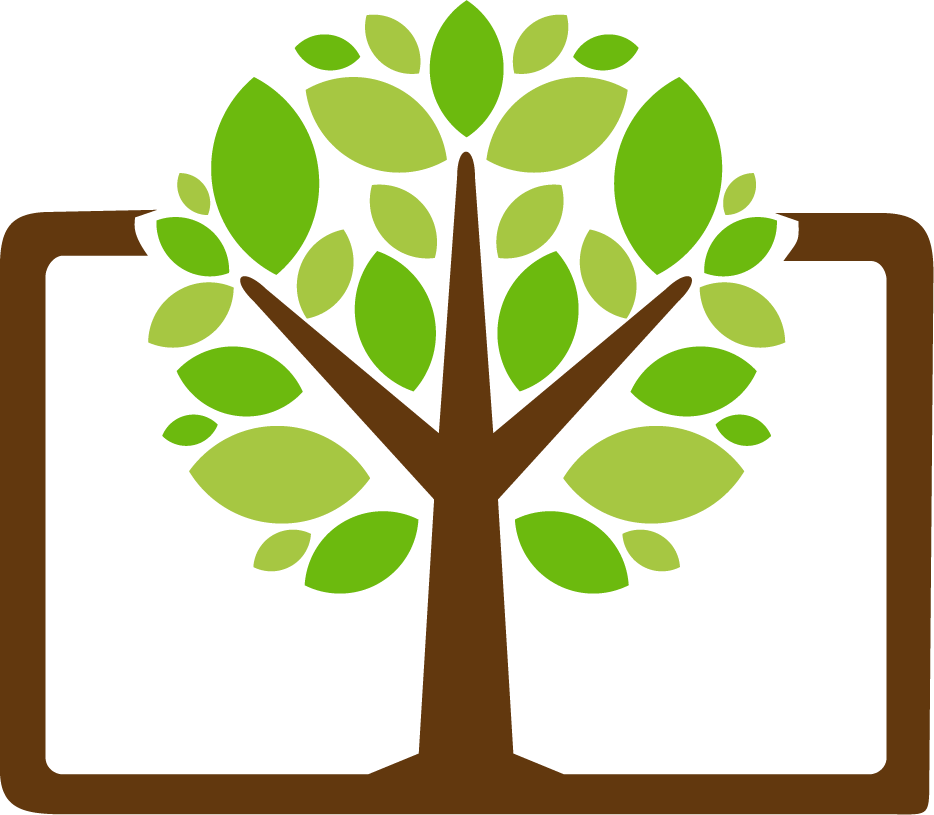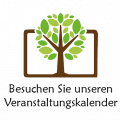„zu disser abschawlich schandt getzwungen“
Ein Justizverfahren wegen Kindesmissbrauchs im 16. Jahrhundert

28. Februar 2025
Bad Homburg (pit). Es war ganz gewiss keine „leichte Kost“, die die Zuhörer des Vortragsabends des Vereins für Geschichte und Heimatkunde Bad Homburg zu genießen bekamen. Immerhin lauschten sie dem Beitrag von Chiara Siebert mit dem Titel „zu disser abschawlich schandt getzwungen[en]“, der sich mit den Strafen gegen die Opfer homosexueller Übergriffe eines Schulmeisters im 16. Jahrhundert in Homburg v. d. Höhe befasste. Im Zuge der Ausarbeitung ihrer Masterarbeit unter dem gleichen Titel hatte sich die Absolventin der Geschichte, Germanistik und Kommunikationswissenschaften ausführlich mit der strafrechtlichen Verfolgung des Schulmeisters Johann Brost und seiner beiden Schüler Theodoricus Balz (15 Jahre) und Hermann Wenigs (15 oder 16 Jahre) befasst.
„Wir befinden uns im Jahr 1582. Zwei Jungen werden vom Gefängnis in Homburg zu einem enthaupteten Leichnam geführt. Bei dem Toten handelt es sich um ihren Lehrer Johann Brost. Am Tag darauf werden eben diese Jungen vom Homburger Gerichtsbüttel solange mit der Rute geschlagen, bis ihnen das Blut die Beine hinab läuft“, schilderte Chiara Siebert gleich zu Anfang die für den heutigen Menschen und die moderne Justiz kaum nachvollziehbare bzw. verständliche Situation. Es folgte eine präzise rechts-, kultur- und sozialgeschichtliche Aufschlüsselung dessen, was einst vorgefallen war.
Der Lehrer, der wegen zweier Besuche des Landgrafen Philipp von Hessen-Rheinfels im Jahr 1581 im Schulhaus übernachtete, hatte vor der ersten Übernachtung die Mutter von Hermann Wenigs überredet, dass ihr Sohn mit ihm in der Schule schlafen sollte. Beim zweiten Mal war es Theodoricus Balz: „Aus der zugehörigen Prozessakte wird allerdings schnell ersichtlich, dass es sich nach heutiger Auslegung bei den Übernachtungen im Schulhaus um sexuellen Missbrauch handelte.“
Nach Bekanntwerden der Tat versuchte Brost zu fliehen, doch sowohl er als auch die Jungen wurden inhaftiert und „am 19. März 1582 wurde der peinliche Prozess gegen Johann Brost, Hermann Wenigs sowie Theodoricus Balz eröffnet“. Die Anlage bestand aus 16 Artikeln und „forderte für alle drei den Tod durch Verbrennen wegen ‚sodomitische[r] schandt, buberej und vnzucht zu etlichen (…) mahlen‘“.
Geständnis unter Androhung von Folter
Unter Androhung der Folter gestand der Schulmeister schließlich seine Taten und bat letztlich um ein günstiges Urteil für sich sowie für die Knaben aufgrund ihrer „blüenden jugent“. Das Gericht habe, so die Referentin, den Schülern im Urteil zugestanden, dass sie zur „Sodomie“ gezwungen worden waren und aufgrund ihres Alters das Delikt selbst sowie dessen Schwere kaum verstehen könnten. Dieses Zugeständnis habe die beiden vor der Todesstrafe bewahrt, Schulmeister Johann Brost sollte jedoch durch das Schwert enthauptet werden: „Wir haben es hier aus frühneuzeitlicher Sicht mit einem vergleichsweise gnädigen Urteil für alle drei Delinquenten zu tun, denn die eigentliche Strafe für Sodomie sah den Tod durch Verbrennen vor.“
Chiara Siebert erläuterte anschließend sehr anschaulich die Entstehung des Sodomie-Begriffs sowie der Strafrechts- und Entscheidungspraxis: „Die strafrechtliche Verfolgung resultierte aus der Erzählung des ersten Buchs Mose über Sodom und Gomorrha. Die Menschen befürchteten bei Verstößen gegen die göttliche Ordnung dasselbe Schicksal zu erfahren – also dem Untergang geweiht zu sein. Naturkatastrophen, Hungersnöte und Kriege galten als solche Folgeerscheinungen für nicht geahndete Sünden.“ Päderastie oder Kindesmissbrauch sei jedoch bis ins 19. Jahrhundert nicht als Straftat in der Gesetzgebung aufgeführt gewesen.

Dann ging es um den Prozess an sich, wobei sich Chiara Siebert insbesondere auf die Verteidigung konzentrierte. Der erste Artikel gleiche einem Plädoyer, in welchem den Delinquenten vorgeworfen worden sei, gegen das weltliche Recht, die Constitutio Carolina Criminalis, sowie das geistliche Recht (die Zehn Gebote) verstoßen zu haben, worauf die Todesstrafe stand. Der zweite beziehe den Schüler Hermann Wenigs mit ein, der dritte und vierte Artikel beziehe sich auf beide Schüler, wie sie mit Brost „Sodomie“ trieben. Der sechste Punkt der Anlageschrift zeige noch deutlicher als der fünfte die sexuelle Gewalt, die den Jungen angetan wurde. Der abschließende zwölfte Artikel bilde den Schluss der Anlageschrift: „Er ist die Urteilsforderung des Anklägers für alle drei Delinquenten.“ Sie sollten „wegen sodomitischer schandt buberej vnd vnzucht zu etlihen vnderschidlichen mahlen“ durch das Feuer hingerichtet werden.
Strafe für Täter und Opfer
Es seien vom Verteidiger Brosts diverse Briefe als Beweise hinzugezogen worden, die Verteidigung der Schüler baute auf die Summe und Wiederholung der Missbrauchsfälle: „Im Vordergrund des Prozesses stand nicht die sexuelle Gewalt, die Brost seinen Schülern angetan hat, sondern vor allem das Delikt als solches. Erst danach wurden die Umstände einbezogen.“ Daher hätten auch die beiden Schüler eine Strafe erhalten. Für die Verurteilung des Schulmeisters fehlte letztlich dessen Geständnis; erst unter Androhung der Folter gab er das Delikt schließlich zu.
Die Enthauptung von Johann Brost als eine „ehrbare“ Todesstrafe und die brutale Prügelstrafe für die Jungen als eine „mildere“ Bestrafung begründeten sich mit der Reue des Täters und seiner Aussage, von Satan dazu verführt worden zu sein, bzw. der Anerkenntnis des Gerichts, dass die Knaben vom Schulmeister zur „Sodomie“ gezwungen worden seien. „Nicht zuletzt war es aber auch nicht ungewöhnlich, dass der Landesfürst die Strafen abmilderte … Die Gewährung einer Strafmilderung diente der Inszenierung als milder, barmherziger Herrscher“, so Chiara Siebert abschließend.
Fragen aus dem Publikum
Das rund 70-köpfige Publikum dankte dem sowohl detailreichen als auch spannenden und somit kurzweiligen Vortrag nicht allein durch Applaus, sondern gleichfalls mit interessierten Fragen. So wollte ein Zuhörer gerne erfahren, wie die Androhung der Folter zu bewerten sei und ob sie einst zu den Rechtsmitteln gehört habe. Es wurde aber auch festgestellt, dass die Homburger Justiz in diesem Fall einerseits ganz offensichtlich überfordert gewesen sei, sich jedoch sehr um eine angemessene Beweisführung und ein ordentliches Verfahren bemüht habe. Auch die Frage, warum die Opfer des Schulmeisters überhaupt noch eine Strafe erhalten mussten, wurde noch einmal in den Raum gestellt. „Es handelte sich hierbei um einen erzieherischen Aspekt“, so Chiara Siebert. Mit dieser Strafe habe man sicher gehen wollen, dass durch die Untat des Lehrers auf keinen Fall die Sodomie in die Jungen „eingepflanzt“ worden sei.