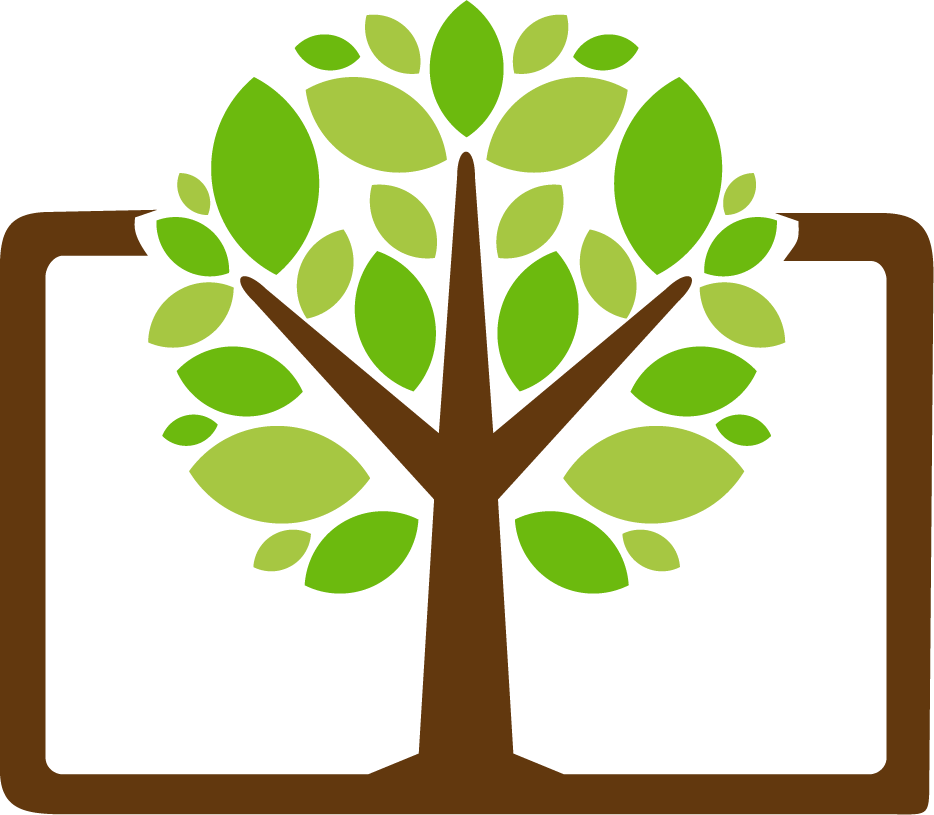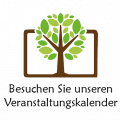Vor 535 Jahren erstmals in Gelnhausen errichtet, seit 200 Jahren in Bad Homburg heimisch
Das Heilige Grab auf dem Reformierten Friedhof















Impressionen von der Feierstunde. - Fotos: Pfeifer
Von Petra Pfeifer, 9. Juli 2025
Bad Homburg v. d. Höhe. „Die […] durch eine Menge Kitt zusammengehaltene Steinmasse […] hat nicht den mindesten materiellen und ebensowenig architektonischen als altertümlichen Wert.“ Dieses vernichtende Urteil fällten vor gut 200 Jahren die zuständigen Behörden des Kreises Gelnhausen in Bezug auf das Heilige Grab, das heute in Bad Homburg zu finden ist. Hintergrund für die Untersuchung war, dass sich exakt dieses Grab, ebenso wie die einstige Michaelskapelle, genau an der Stelle befand, wo vor Ort die Fernstraße, die die Messestädte Frankfurt und Leipzig verband, ausgebaut werden sollte. Ergo: „Die Erhaltung dieses wertlosen Gemäuers erscheint daher völlig zwecklos und durchaus nicht wünschenswert, indem dadurch der so wohltätige Zweck der gehörigen Erweiterung der sehr frequentierten und an dieser Stelle so sehr benutzten Leipziger Straße nicht erreicht, sondern völlig vereitelt werden würde.“
Während der benachbarten Michaelskapelle kein gnädiges Schicksal beschieden war und sie weichen musste, ging das Gelnhäuser Heilige Grab durch den Straßenbau nicht für alle Zeiten verloren. „Das liegt daran, dass die Gelnhäuser Fortschrittlichkeit die Homburger Romantik auf den Plan rief – in Person des Landgrafen Friedrich VI. Joseph, der das Heilige Grab erwarb, um es in seiner Residenzstadt wieder aufzubauen“, so Gregor Maier, Vorsitzender des Vereins für Geschichte und Landeskunde Bad Homburg vor der Höhe, in seiner kurzweiligen Erläuterung der damaligen Ereignisse im Rahmen einer kleinen Feierstunde zum 200. Jahrestag der Grundsteinlegung des Grabes auf dem Reformierten Friedhof in Bad Homburg.
 Diese Feierstunde bildete den Abschluss einer Veranstaltungsreihe rund um das kleine Gebäude mit seiner abwechslungsreichen Geschichte, die von mehreren Teilen unter der Überschrift „Ironie der Geschichte“, die Gregor Maier ebenfalls vortrug, begleitet war und zum Schmunzeln brachte.
Diese Feierstunde bildete den Abschluss einer Veranstaltungsreihe rund um das kleine Gebäude mit seiner abwechslungsreichen Geschichte, die von mehreren Teilen unter der Überschrift „Ironie der Geschichte“, die Gregor Maier ebenfalls vortrug, begleitet war und zum Schmunzeln brachte.
Zu Teil eins berichtete er, dass die Gelnhäuser nur 13 Jahre nach dem Abriss aufgrund des Baus einer Umgehungsstraße im Jahr 1838, der heutigen Barbarossastraße, wieder Platz für das Heilige Grab gehabt hätten.
Des Weiteren habe sich am Abend der Grundsteinlegung, die eigentlich am 20. Juni 1825 stattfinden sollte, eine regelrechte Katastrophe ereignet, die der damalige Hofbibliothekar in einem Tagebucheintrag geschildert habe: „Abends halb sieben Uhr sollte der Akt vor sich gehen, zu welchem mehrere Herren aus der Stadt eingeladen waren, und die Höchsten Herrschaften wurden mit jedem Augenblick erwartet, als ein Maurer, welcher den Grundstein von dem ihm noch anhangenden alten Mörtel reinigen wollte, Spuren einer Schrift entdeckte. Bei genauer Nachforschung zeigte sich eine in Stein eingehauene Zeichnung, in welcher sich bei genauer Vergleichung die Jahreszahl 1490 nicht verkennen ließ. Se. Hochf. Durchl. der souv. Landgraf, welcher unterdessen mit der Frau Lgfin Kgl. Hoheit und Höchstihrem Herrn Bruder Prinz Louis Hochfürstl. Durchl. angekommen waren, ließen sofort die Arbeit einstellen.“
Denn der Landgraf und seine Gattin, Landgräfin Elisabeth von Großbritannien, die zu jener Zeit ganz im Zeichen der Romantik in Homburg mit einigen Projekten ein etwas „inszeniertes Mittelalter“ schufen, hatten im Vorfeld die Hoffnung gehegt, ein Gebäude der Staufer erstanden zu haben.
Doch gekauft war nun mal gekauft, und so fand am 23. Juni vor 200 Jahren im zweiten Anlauf dann doch noch eine feierliche Grundsteinlegung statt. „Der eigentliche Held der Geschichte ist also jener gründlich arbeitende Homburger Handwerker, ohne den wir bis heute nicht wüssten, wann das Heilige Grab in Gelnhausen errichtet wurde. Es ist wiederum eine Ironie der Geschichte, Teil 3, dass wir nicht einmal seinen Namen kennen“, so Gregor Maier. Abschließend versicherte er in Richtung Christian Litzinger, Bürgermeister von Gelnhausen, der gemeinsam mit einer kleinen Delegation aus Gelnhausen, bestehend aus Vertretern der Stadt, der Kirchengemeinde und des dortigen Geschichtsvereins, zu der Feierstunde angereist war: „Wir passen auch weiterhin gut darauf auf.“
Landrat Ulrich Krebs war in erster Linie als „interessierter Bürger“ gekommen: „Das Heilige Grab ist vielleicht etwas unscheinbar, aber ein wichtiges und bedeutendes Kulturdenkmal. Daher war es ein Glücksfall, dass der Landgraf es gerettet hat.“ Selbstverständlich wisse er nicht, welche Gefühle in Gelnhausen herrschten angesichts der Tatsache, dass es nun in Bad Homburg steht. „Vielleicht Trauer, vielleicht Freude, dass es erhalten geblieben ist“, so Krebs. Auf jeden Fall dankte er sowohl der Erlöserkirchengemeinde, die sich um den Erhalt des Bauwerks kümmert, als auch dem Geschichtsverein und dem Stadtarchiv für die gemeinsamen Bemühungen, das Heilige Grab in der Öffentlichkeit bekannt zu machen.
Etwas nachdenklich fügte er an: „Vielleicht passt dieser Abend auch, einen Blick in die Welt zu werfen und sich Frieden für das Heilige Land, für den Nahen Osten zu wünschen, der nie weiter davon entfernt war wie aktuell.“
„Ich finde es immer spannend zu entdecken, wieviel Geschichtsträchtiges es in Stadt, Kreis und Region zu entdecken gibt“, sagte Stadtrat Tobias Ottaviani. Das Heilige Grab in Bad Homburg erinnere an die Grabeskirche in Jerusalem, die er bereits besucht habe und diesbezüglich fügte er an: „Das macht was mit einem.“
 Gelnhausens Bürgermeister Christian Litzinger gab zu: „Ich bin mit einem lachenden und einem weinenden Auge hier.“ Er könne sich gar nicht vorstellen, was in den Köpfen der Stadtväter Gelnhausens einst vor sich gegangen sei, freue sich aber, dass dieses Bauwerk gut erhalten ist und gepflegt werde.
Gelnhausens Bürgermeister Christian Litzinger gab zu: „Ich bin mit einem lachenden und einem weinenden Auge hier.“ Er könne sich gar nicht vorstellen, was in den Köpfen der Stadtväter Gelnhausens einst vor sich gegangen sei, freue sich aber, dass dieses Bauwerk gut erhalten ist und gepflegt werde.
Einer, der daran maßgeblich Anteil hat, ist Dr. Alexander von Oettingen, der Vor-Vorgänger von Pfarrer Andreas Hannemann, der gerne einen Abriss über die Sanierung des Bauwerks gab und auch eine begleitende Ausstellung konzipiert hat, die aktuell in der Erlöserkirche zu sehen ist (s.u.). „Im Grundstein wurde sogar ein Glasgefäß gefunden, das eindeutig Wasser vom Jordan enthielt“, berichtete er. Das hiesige Heilige Grab sei somit nicht einfach ein Ort, den man mal besuche, „sondern an dem man sich der vielen Bezüge bewusst wird“.
Pfarrer Andreas Hannemann: „Wir brauchen diese Orte der Erinnerung, der Vergegenwärtigung – daher investieren wir bei baulichen Erhaltungsmaßnahmen nicht in Steine, sondern in Menschen.“ Er hoffe, dass Besucher hinterfragen, was das für ein Ort ist. Somit: „Wenn Steine dafür sorgen, dass Menschen wieder menschlich werden, müssen wir investieren.“
Für die gelungene musikalische Begleitung dieser Feierstunde sorgten der Posaunenchor der Erlöserkirche sowie Susanne Rohn und zwei Chorsängerinnen mit Gesängen aus dem Umfeld der Heilig-Grab-Liturgie.
Der Friedhof Untertor, der auch wegen seiner historischen Gräber unbedingt eine Besichtigung wert ist, ist täglich von 8 bis 17 Uhr geöffnet. Allerdings ist die Besichtigung des Innenraums des Heiligen Grabes nur im Rahmen einer Stadtführung möglich.

Ausstellung zum Heiligen Grab in der Erlöserkirche
Um dieses unscheinbare, aber bedeutende Kulturdenkmal über die Jubiläumsveranstaltungen hinaus im Bewusstsein der Bad Homburger:innen präsent zu halten, hat die Erlöserkirchengemeinde in Zusammenarbeit mit dem Geschichtsverein drei Informations-Aufsteller gestalten lassen, die im Vorraum der Erlöserkirche über das Heilige Grab informieren. „Vielen ist gar nicht bewusst, dass zu den Kulturschätzen unserer Gemeinde auch das Heilige Grab gehört – das wollen wir ändern“, begründet Pfarrer Andreas Hannemann das neue Informationsangebot.
Die drei Ausstellungstafeln erläutern die theologischen und historischen Zusammenhänge, in denen das Heilig-Grab-Gebäude steht. Außerdem berichten sie über die Sanierung des Baudenkmals in den Jahren 2002 bis 2004 und seine heutige Nutzung. Konzipiert wurden die Inhalte von Pfarrer i. R. Dr. Alexander von Oettingen.
Die kleine Ausstellung im Vorraum der Erlöserkirche in Bad Homburg ist zu deren Öffnungszeiten zugänglich – täglich außer montags von 10 bis 17 Uhr, im Winter (Ewigkeitssonntag bis Ostern) von 12 bis 16 Uhr.